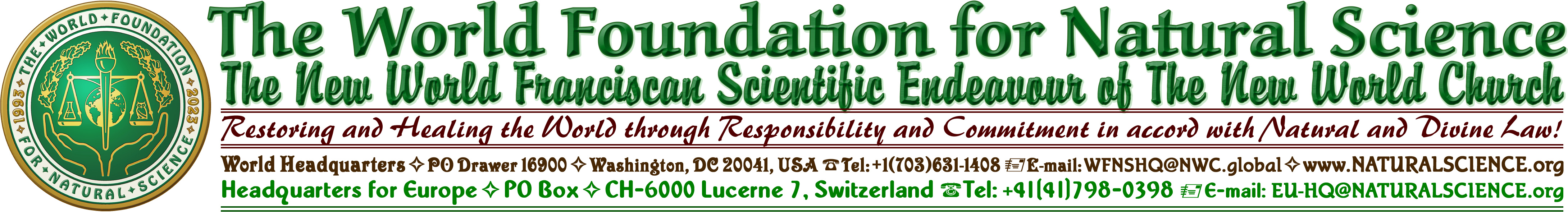Manchmal sehen und erkennen wir umso weniger, je näher wir uns an einer Sache befinden. Das machen sich beispielsweise Magier und Illusionisten zunutze, um das Publikum mit ihren Tricks in Erstaunen zu versetzen. Doch vielleicht gilt das auch für unsere Sicht auf die Natur und die Erde. Wir verlassen uns auf die Solidität des Bodens unter unseren Füßen. Wir rechnen fest damit, dass die Sonne jeden Tag aufgeht. Wir akzeptieren das, was unsere Forschungen als Erkenntnisse hervorbringen, als Fakt und Gesetz. Wir haben, anders als unsere Vorfahren, verstanden, dass die Erde kugelförmig und in ein riesiges Sonnensystem eingebettet ist. Dieses wiederum gehört zu einer Galaxie, der Milchstraße, die wiederum Teil eines noch größeren Systems ist und so weiter.
Gleichzeitig ächzt die Erde unter dem Gewicht der Auswirkungen des menschlichen Handelns. Wir plündern und verschmutzen die Natur, als ob es kein Morgen gäbe. Wir führen Kriege, welche die Erde auf vielfache Weise schlimmer schädigen als jede sogenannte Naturkatastrophe. Wir tun gerade so, als ob wir eine neue Pop-up-Erde in der Schublade liegen hätten.
Dass dem nicht so ist, haben jene wenigen Menschen begriffen, welche die Gelegenheit zu einem radikalen Perspektiven-Wechsel hatten: die Astronauten, die unsere Erde aus der Distanz des Weltalls gesehen haben und das erlebten, was man den Overview-Effekt nennt. „Es ist so unfassbar schön, dass man eigentlich neue Wörter bräuchte, um es zu beschreiben. Man ist überwältigt“, schwärmte Leland Devon Melvin, ehemaliger American Football-Profi und US-Astronaut, der im November 2009 mit der Raumfähre Atlantis zur Internationalen Raumstation (ISS) flog.
 Wer die Erde „von oben“ sieht, erkennt die Künstlichkeit unserer menschengemachten Grenzen. Denn wo beginnt eine Kugel? Wo ist das Ende des Ozeans? Wo ist der Anfang von Wetterereignissen wie Regen oder Sturm und wo endet ein Sonnenstrahl? „Aus dem Weltraum sah ich die Erde nicht als eine Ansammlung von Nationen, sondern als ein einziges Gebilde mit einem einzigen Schicksal“, sagte der ISS-Astronaut Ron Garan. Ähnlich empfand die Space Shuttle-Astronautin Mae Jemison: „Wenn man die Erde aus dem Weltraum betrachtet, wird einem klar, dass unser Planet ein wunderschönes, zusammenhängendes System ist. Wir sitzen alle im selben Boot.“
Wer die Erde „von oben“ sieht, erkennt die Künstlichkeit unserer menschengemachten Grenzen. Denn wo beginnt eine Kugel? Wo ist das Ende des Ozeans? Wo ist der Anfang von Wetterereignissen wie Regen oder Sturm und wo endet ein Sonnenstrahl? „Aus dem Weltraum sah ich die Erde nicht als eine Ansammlung von Nationen, sondern als ein einziges Gebilde mit einem einzigen Schicksal“, sagte der ISS-Astronaut Ron Garan. Ähnlich empfand die Space Shuttle-Astronautin Mae Jemison: „Wenn man die Erde aus dem Weltraum betrachtet, wird einem klar, dass unser Planet ein wunderschönes, zusammenhängendes System ist. Wir sitzen alle im selben Boot.“
Doch stellte sich bei den Astronauten nicht nur ein tiefes Gefühl der Verbundenheit mit allem Leben auf der Erde ein, sondern sie erkannten gleichzeitig die Fragilität und Kostbarkeit unseres Planeten und dass wir die Verantwortung haben, für unser Zuhause im Kosmos Sorge zu tragen. „Aus dem Weltraum sieht man die Schönheit und Zerbrechlichkeit unseres Planeten. Es ist eine Erinnerung daran, dass wir alle diese gemeinsame Heimat teilen und dass wir uns um sie kümmern müssen“, beschrieb die ISS-Astronautin Karen Nyberg diese Erkenntnis. Keiner der Menschen, die unsere Erde mit neuen Augen sehen durften, war der Meinung, sie habe ausgedient und wir sollten uns auf die Suche nach einem neuen Heimatplaneten machen, dem Mars etwa. Vielmehr waren sie alle überzeugt, dass wir gemeinsam Lösungen für die heutigen Probleme finden können: „Aus dem Weltraum erkennt man, wie klein und miteinander verbunden wir alle sind. Diese Perspektive kann uns dazu inspirieren, bessere Verwalter unseres Planeten zu sein und auf eine bessere Zukunft hinzuarbeiten“, meinte der ISS-Astronaut Scott Kelly.
 Versuchen wir also, am diesjährigen Tag der Erde unsere Welt mit ganz neuen Augen zu sehen, denn wie seinerzeit Bette Middler sang:
Versuchen wir also, am diesjährigen Tag der Erde unsere Welt mit ganz neuen Augen zu sehen, denn wie seinerzeit Bette Middler sang:
„Aus der Ferne sieht die Welt blau und grün aus … Aus der Ferne herrscht Harmonie … Aus der Ferne sind wir Instrumente. Marschieren in einer gemeinsamen Band. Spielen Lieder der Hoffnung, spielen Lieder des Friedens. Es sind die Lieder eines jeden Menschen.“